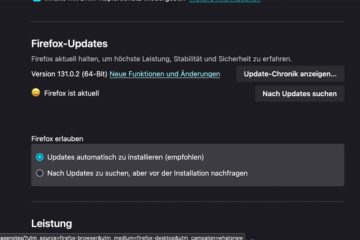Sie suchen einen bezahlbaren Plattenspieler? Namhafte Hersteller wie Audio-Technica, Dual und Sony haben solide Modelle zu fairen Preisen im Angebot. Damit versprechen sie den bei Vinyl-Fans beliebten warmen Analogklang. Manche knüpfen sogar ans Digitalzeitalter an und bieten Streaming per Bluetooth oder sogar per WLAN. Aber was genau ist bei Plattenspielern für ein gutes Klangerlebnis wichtig? Und welche Ausstattung ist wirklich notwendig? Dieser Test gibt Antworten und verrät, welcher Plattenspieler die Versprechen am besten einlöst. Die getesteten Modelle liegen zwischen knapp 200 und 1.000 Euro – und dafür gibt es bei manchen Herstellern verblüffend viel technischen wie klanglichen Gegenwert.

Der günstige Audio-Technica (links) und der Technics SL-1500C sehen sich ähnlich, Letzterer verfügt aber über die viel höherwertige und besser verarbeitete Mechanik.
Foto: COMPUTER BILD
Erfolgreich aufs Wesentliche reduziert: Der Reloop Turn 2 geizt mit Komfort-Features und benötigt zum Anschluss einen Phonoeingang – ein Vorverstärker ist nicht eingebaut. Immerhin ist die Drehzahl am seitlich versteckten Schalter wählbar, sodass nicht wie bei noch stärker reduzierten Modellen der Antriebsriemen per Hand an der Motorachse umgelegt werden muss. Außerdem beeindruckte er mit einem sehr guten Tonarm für seine Preisklasse. Dazu passt der montierte und vergleichsweise hochwertige Tonabnehmer sehr gut. Der Antrieb agiert unauffällig und hält sich mit Störgeräuschen zurück. Klanglich ist der Reloop Turn 2 sehr ausgewogen, kraftvoll und sauber – in der Preisklasse unter 300 Euro (Stand: Juli 2024) kaum zu toppen.

Reloop Turn 2: gute Verarbeitung zum günstigen Preis.
Foto: Reloop
Klangqualität:
Das Wichtigste im Test von Plattenspielern ist die Klangqualität. COMPUTER BILD prüft jeden Plattenspieler im Vergleich mit bereits getesteten Modellen an hochwertigen Stereo-Anlagen. Dabei kommt der serienmäßig montierte Tonabnehmer zum Einsatz, dessen Justage prüfen die Tester vor dem Start. Bei Plattenspielern mit eingebautem Vorverstärker ist dieser zugeschaltet.

Plattenspieler im Test: Mit speziellen Testplatten lassen sich zum Beispiel Gleichlaufschwankungen, Geschwindigkeitsabweichungen und Klangverfärbungen ermitteln.
Foto: COMPUTER BILD
Antriebseinflüsse:
Bei der Wiedergabe von Schallplatten kommt es auf eine sehr präzise Mechanik an. Die ins Vinyl gravierten Schwingungen haben bei einer Tonhöhe von 10.000 Hertz eine Auslenkung von nicht einmal zwei Mikrometern – das entspricht etwa einem Dreißigstel eines menschlichen Haars! Mit noch höheren Frequenzen, die zumindest junge Menschen noch wahrnehmen, sind die Auslenkungen in der Rille noch kleiner. Sobald also am Plattenspieler irgendetwas ungewollt vibriert, wenn der Tonarm im Lager wackelt oder Motorschwingungen die Platte erreichen, überdecken solche Störungen schnell die winzigen Schwingungen in der Plattenrille. Der Plattenspieler hat so die Aufgabe, die Nadel sehr präzise und ruhig durch die Rille zu führen. Motorvibrationen können hörbare Spuren im Musiksignal hinterlassen, ebenso das Rumpeln eines nicht perfekt gleitenden Tellerlagers oder Resonanzen eines mitschwingenden Plattentellers. COMPUTER BILD ermittelt diese Antriebseinflüsse sowohl mit herkömmlichen als auch mit speziellen Test-Schallplatten.
Funktionen:
Plattenspieler gibt es von puristisch bis komfortabel. Im Test prüft COMPUTER BILD, welche Geschwindigkeiten wählbar sind, ob eine Feineinstellung (Pitch) vorhanden ist und ob am Tonarm Auflagekraft und Antiskating einstellbar sind. Auch höhenjustierbare Gerätefüße und eine Staubschutzhaube zahlen auf das Testergebnis ein. Ganz wichtig sind die Anschlüsse: Bei Modellen mit eingebautem Vorverstärker können Nutzerinnen und Nutzer oft zwischen Phono- und Line-Ausgang umschalten. Damit eignet sich jede Stereo-Anlage als Mitspieler, egal ob mit Phono-Eingang oder mit herkömmlichem Stereo-Eingang. Nur einen geringen Einfluss auf die Note hat ein USB-Anschluss. Darüber lassen sich Schallplatten am PC digitalisieren.

Die Auflagekraft, mit der die Nadel in die Rille drückt, ist meistens am Gegengewicht einstellbar. Das Rädchen am Tonarmlager bestimmt das Antiskating.
Foto: Thomson
Bedienung:
Wie viel handwerkliches Geschick ist erforderlich, um zur Inbetriebnahme die einzelnen Komponenten zu einem funktionierenden Plattenspieler zusammenzusetzen? Da gilt es zumindest, den Plattenteller aufzulegen und am Tonarm das Gegengewicht zu montieren, das sollte unkompliziert möglich sein. Im Test prüft COMPUTER BILD, ob die mitgelieferte Anleitung diese Schritte verständlich erklärt. Außerdem ist eine einfache Handhabung im Alltag, etwa ein gut funktionierender Tonarmlift und eine einfache Geschwindigkeitsumschaltung entscheidend für die Testnote. Perfekt für Ungeübte sind vollautomatische Plattenspieler, die auf Knopfdruck den Motor starten, den Tonarm über die Schallplatte bewegen und absenken. Nach dem Ende einer Plattenseite heben Vollautomaten die Nadel aus der Rille, führen den Tonarm zurück und schalten den Motor aus.

Plattenspieler im Mini-Format: Auf den ersten Blick könnte man den Audio Technica AT-SB727 für ein Spielzeug halten.
Foto: COMPUTER BILD
Etliche Plattenspieler im Test zeigen beim Laufwerk eine nahe Verwandtschaft: So verwenden Audio-Technica, JBL, Lenco, Reloop, Roberts und Teac bei ihren günstigen Modellen nahezu identische Plattenteller aus dünnwandigem Aluguss. Ihr Gewicht unterscheidet sich nur geringfügig – die Teller wiegen zwischen 500 und 600 Gramm. Das ist nicht viel, zumal die serienmäßigen Filzmatten mit unter 20 Gramm kaum zur Erhöhung der für den Gleichlauf wichtigen Schwungmasse beitragen. Audio-Technica leistet sich statt Filz eine Gummiauflage, die 200 Gramm extra bringt. Damit kommt der Audio-Technica AT-LPW50PB an den Pro-Ject E1 Phono mit seinem Plattenteller aus Polymer-ABS heran. Der günstige Thomson TT-700 verwendet dagegen Holz für den Plattenteller. Das Material ist deutlich weniger dich, entsprechend gering fällt die Schwungmasse aus. Massivere Plattenteller mit entsprechend höherer Schwungmasse finden sich in der gehobenen Preisklasse ab 500 Euro, etwa beim Pro-Ject Debut Carbon EVO beim Dual CS418 und CS518.

Der JBL Spinner BT entstammt dem gleichen Baukasten wie viele Konkurrenten, hier passt aber das Zusammenspiel von Motor, Plattenteller, Tonarm und Audio-Technica-Tonabnehmer besonders gut.
Foto: COMPUTER BILD
Für günstige Plattenspieler hat sich die Kunst des Weglassens bewährt: Bewusst einfache Konstruktionen verzichten auf alles, was akustisch Ärger machen könnte. Oder was nur mit teurem Aufwand die Wiedergabe nicht stören würde. Die meisten aktuellen Plattenspieler halten daher ihren Teller über einen Riemen aus Gummi in Schwung. Für HiFi-Laufwerke in dieser Preisklasse ist das vernünftig, weil so ein elastischer Riemen Motor-Vibrationen gut herausfiltert. Die wichtigsten Pflichten eines Plattenspielers sind Laufruhe und eine absolut stabile Drehzahl. Die sind aber nicht schon erfüllt, wenn ein Spieler nicht deutlich hörbar leiert. Weit unterhalb der Schwelle, ab der das Gehör Drehzahlschwankungen als Tonhöhenschwankungen wahrnimmt, beeinträchtigen Gleichlaufstörungen die Stabilität der Stereowiedergabe und die Reinheit des Tons. Kurz: Schon im Laufwerk entscheidet sich, ob aus den in die Rillen gravierten Wellengebirgen am Ende wieder glaubhafte, greifbar plastische Sänger und Instrumente werden.

Beim Pro-Ject Primary E ist der außen liegende Motor schön laufruhig, die Drehzahlwahl erfolgt an der Riemenscheibe.
Foto: COMPUTER BILD

Bei den meisten Plattenspielern ist die Drehzahl elektronisch umschaltbar, im Bild Audio-Technica.
Foto: COMPUTER BILD
Neben dem Laufwerk kommt dem Tonarm eine Schlüsselrolle zu: Er muss dem Tonabnehmer reibungsfrei folgen und gleichzeitig beträchtliche Mengen an mechanischer Energie verarbeiten. Der Abspielvorgang überträgt Vibrationen auf den Tonabnehmer und damit auch den Arm. Wer mit dem Ohr nahe an einen laufenden Spieler herangeht, kann die oft deutlich hören. Wirken diese Vibrationen auf den Tonabnehmer zurück, beeinträchtigen sie die Klangqualität. Erstrebenswert sind also Steifigkeit und Resonanzarmut bei nicht zu hohem Eigengewicht. Das Armrohr der Pro-Ject-Plattenspieler ist einteilig. Beim Debut Evo Carbon webt der Hersteller Rohr und Headshell nach einem ausgefeilten Verfahren in einem Arbeitsgang aus Kohlefaser. Filigraner sind die Arme von JBL, Lenco, Reloop, Roberts, Thorens, Teac und Audio-Technica, die augenscheinlich aus der gleichen Fabrik stammen. Während der beim Reloop Turn 2 im Test mit guter Präzision und kraftvollem Klang vollends überzeugte, machte sich bei den anderen leichtes Lagerspiel bemerkbar – was möglicherweise das leichte Autoritäts-Defizit im Bass erklärt, den diese Spieler im Hörtest zeigten.

Der Technics SL-1500C verfügt über einen hervorragenden Tonarm mit präziser Lagerung.
Foto: COMPUTER BILD
Sony und Thomson greifen für ihre 200-Euro-Plattenspieler zu arg kompromissbelasteten Konstruktionen: Dem Sony-Arm fehlt ein Gegengewicht und damit die Einstellbarkeit der Auflagekraft. Die liegt mit 4 Gramm deutlich über der Empfehlung und ist absolut betrachtet einfach unnötig hoch. Damit verschleißen Nadel und Platten schneller. Zudem ist der Tonabnehmer dem schönen Design zuliebe fest montiert. Mangels Verstellbarkeit wäre jedoch der Arm ohnehin nicht auf andere Tonabnehmer justierbar. Beim Thomson-Arm sind zwar Gewicht und Antiskating einstellbar, allerdings haben die Lager so viel Spiel, dass die Abtastsicherheit des Arms massiv leidet.

Mit Carbon-Tonarm und Ortofon-Tonabnehmer ist der Pro-Ject Debut Evo Carbon in der Preisklasse um 500 Euro kaum zu schlagen.
Foto: Pro-Ject

Viele günstige Plattenspieler sind mit einem Tonabnehmer von Audio-Technica ausgestattet – da gibt es gute Qualität fürs Geld und günstige Ersatznadeln.
Foto: Audio Technica
Pro-Ject, Music Hall und Technics kaufen bei Ortofon in Dänemark. In den günstigen Pro-Ject-Modellen stecken Systeme der bewährten Modellreihe OM, im Debut Carbon Evo gibt es wie bei den beiden anderen das hochwertige, um die 100 Euro teure Ortofon 2M Red – was man hört: Ihre Palette an Klangfarben ist reicher als die der anderen Spieler, Details separiert es schöner. Wem das nicht reicht, der kann beim nächsten fälligen Nadeltausch auch den feinen Diamanten des 2M Blue einwechseln – mit ihrem Potenzial können die Spieler ein solches Upgrade auch hörbar machen. Ein Austausch der Nadel empfiehlt sich nach 500 bis 1000 abgespielten Schallplatten. Dank sogenanntem Moving-Magnet-(MM-)Prinzip ist das mit einem einfachen Handgriff möglich, mit Preisen zwischen 20 und 50 Euro hält sich auch der finanzielle Aufwand bei diesen Tonabnehmern im Rahmen. Vielhörende machen oft den Fehler, Nadeln in fragwürdigem Zustand weiterzunutzen, weil ihnen vor dem Preis des Ersatzteils graut. Doch sowohl aus klanglicher Sicht als auch zur Schonung der Platten gilt: lieber viermal eine günstige Nadel ersetzt als einmal zu wenig den Edeldiamanten.

Wird der Plattenspieler an einen Verstärker mit Phono-Eingang angeschlossen, ist zusätzlich eine Verbindung zwischen beiden Erdungsklemmen erforderlich – sonst brummt es.
Foto: COMPUTER BILD
Die Auswahl neuer Plattenspieler ist so groß wie seit Jahren nicht mehr – ein Zeichen der anhaltend starken Nachfrage. Preisbewusste Käuferinnen und Käufer werden schon für rund 300 Euro fündig. Wichtigster Tipp in dieser Preisklasse: möglichst wenig Ausstattung. Denn dann kommt das Budget bei klug konzipierten Geräten ganz dem Klang zugute, der Reloop Turn 2 und der Pro-Ject E1 machen es vor. Die 500-Euro-Preisklasse bietet luxuriöser anmutende Plattenspieler mit feinerem Klang, etwa das Geschwisterpaar Dual CS418 und CS518 oder den Pro-Ject Debut Carbon EVO. Ganz vorne in der Bestenliste rangiert der Technics SL-1500C, die Wohnzimmer-Ausführung des legendären DJ-Plattenspielers mit toller Verarbeitungsqualität und feinster Mechanik.
Häufige Fragen zu Plattenspielern
Was ist der beste Schallplattenspieler?
Der beste Schallplattenspieler verfügt über eine präzise gefertigte Mechanik mit perfekter Laufruhe und über einen sehr guten Tonabnehmer. Das ist die Voraussetzung, dass er alle Klanginformationen aus der Plattenrille in elektrische Schwingungen umwandeln kann – ohne leiernde Drehzahlschwankungen, mit unverzerrten Höhen und sauberen Bässen. Außerdem ist der beste Plattenspieler einfach zu bedienen und unkompliziert in der Handhabung. Der Testsieger von COMPUTER BILD erfüllt diese Anforderungen.
Welcher Plattenspieler klingt am besten?
Im Plattenspieler-Test von COMPUTER BILD erwies sich der Testsieger als das Modell mit dem besten Klang. Die direkt dahinter platzierten Modelle folgten dicht mit nur geringen Abstrichen bei der Klangqualität.
Auf was muss man beim Kauf eines Plattenspielers achten?
Das Wichtigste ist eine solide mechanische Qualität als Voraussetzung für eine saubere Schallplattenwiedergabe. Außerdem sollte die Handhabung einfach sein, etwa mit einem guten Tonarmlift und einer einfachen Geschwindigkeitsumschaltung. Wichtig für die Praxis: eine Staubschutzhaube. Außerdem spielt die vorhandene Stereo-Anlage eine wichtige Rolle: Wenn die keinen Phono-Eingang hat, sollte der Plattenspieler einen eingebauten Vorverstärker haben.
Sind neue Plattenspieler besser als alte?
Bei neuen Plattenspielern weiß man eher, worauf man sich einlässt. Wenn Testergebnisse vorliegen und Probehören möglich ist, sind die der sicherere Kauf.
Was braucht man zusätzlich zu einem Plattenspieler?
Zusätzlich zum Plattenspieler ist eine Stereo-Anlage erforderlich. Im einfachsten Fall können das Stereo-Boxen mit eingebautem Verstärker sein, sogenannte Aktiv-Boxen. Daran lassen sich Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker anschließen – fertig. Die klassische Anlage besteht aus einem Stereo-Verstärker und zwei (passiven) Lautsprecherboxen.
Wie schließt man einen Plattenspieler an?
Je nach Plattenspieler und Anlage gibt es zwei Varianten, um Plattenspieler anzuschließen: Die klassische Variante gilt für Plattenspieler ohne eingebauten Vorverstärker. Sie werden per Cinch-Kabel (in der Regel mitgeliefert) an den Phono-Eingang der Stereo-Anlage angeschlossen. Zusätzlich ist eine Masseverbindung oder ein Erdungskabel erforderlich. Dafür gibt es in der Regel eine Schraubklemme neben dem Phono-Eingang. Der Plattenspieler hat entweder ebenfalls eine Klemme oder ein fest montiertes Audio-Kabel inklusive zusätzlichem Massekabel. Die zweite Variante: Plattenspieler mit eingebautem Vorverstärker haben einen sogenannten Line-Ausgang. Der lässt sich mit jedem herkömmlichen Stereo-Eingang einer Anlage verbinden, etwa mit “Aux”, “CD” oder “Line-In” beschriftet.
Was bringt ein Plattenspieler mit USB?
Plattenspieler mit USB lassen sich direkt mit Computern verbinden, um die Musik von Schallplatten digital abzuspeichern. Das klappt allerdings auch auf analogem Weg, etwa vom Tape-Ausgang des Stereo-Verstärkers, der den Audio-Eingang des Computers füttern kann.
Wie viel kostet ein Plattenspieler?
Ordentliche Plattenspieler gibt es ab etwa 200 Euro aufwärts, qualitätsbewusste Musik-Fans sollten einen Preis ab 400 Euro einkalkulieren. Billigere Modelle machen kaum Freude, nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
Kann ich einen Plattenspieler an eine Soundbar anschließen?
Wenn der Plattenspieler mit einem integrierten Vorverstärker ausgestattet ist und somit über einen Line-Ausgang verfügt und die Soundbar einen Stereo-Eingang (Aux-In) hat, steht der Verbindung nichts im Wege.